Happige 1.590 Euro muss Michael Z. für die Werbebotschaft auf einem Klinik-Transporter bezahlen. Und das, obwohl der Physiotherapeut seine Unterschrift unter den Anzeigenvertrag per Fax widerrief, kaum dass der Vertreter seine Praxis verlassen hatte. Was der Jungunternehmer nicht wusste: Ein Widerrufsrecht haben nur Privatleute. Wer für seinen Betrieb Verpflichtungen eingeht, kann sich hinterher nicht auf den Verbraucherschutz berufen.
Klar: Haustürgeschäfte, Darlehensverträge, Ratenverträge oder auch Bestellungen per Telefon oder via Internet dürfen widerrufen werden - vorausgesetzt, die normalerweise 14-tägige Widerrufsfrist wird eingehalten. Mehr noch: Fehlt eine wirksame Widerrufsbelehrung, ist ein Widerruf sogar unbefristet möglich. Bestimmte Formvorschriften gibt es nicht. Schlüssiges Verhalten (z. B. Rücksendung der Ware) reicht vollauf. Gründe für den Widerruf müssen ebenfalls nicht angegeben werden: Der Vertrag ist automatisch null und nichtig.
Klar? Von wegen: Wenn du als Gründer vertragliche Verpflichtungen für deinen Betrieb eingehst, kannst du dich hinterher nicht auf die Widerrufsrechte des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) berufen! Selbst wenn du mit deiner Geschäftsidee noch keinen einzigen Cent verdient hast, gilt für dich das Grundgesetz des Vertragsrechts: "Pacta sunt servanda" - zu deutsch: Einmal geschlossene Verträge müssen eingehalten werden.
Widerruf nur als Schutz für Endverbraucher
Hintergrund: Der Ausweg des Widerrufs dient lediglich dem Schutz von Endverbrauchern im Geschäftsleben. Zwar ist die Unterscheidung zwischen Privatleuten (= Verbrauchern) und Geschäftsleuten (= Unternehmern) nicht auf allen Rechtsgebieten eindeutig geregelt - in Bezug auf den Verbraucherschutz ist das BGB aber recht unmissverständlich:
Als schutzloser "Unternehmer" gilt demnach jede natürliche oder juristische Person, "die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt."
Nicht Zeitpunkt, sondern Zweck entscheidet
Wichtig: Seit wann jemand selbständig ist, ob das Gewerbe bereits angemeldet, der Geschäftsbetrieb schon aufgenommen wurde oder das Unternehmen auf Dauer am Markt bestehen kann, spielt im Zweifel keine Rolle! Dass die Unternehmereigenschaft bereits in der Vorgründungsphase greift, hat der Bundesgerichtshof 2005 in einem Grundsatzurteil entschieden:
"Es besteht ferner kein Anlaß, demjenigen Verbraucherschutz zu gewähren, der sich für eine bestimmte gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit entschieden hat und diese vorbereitende oder unmittelbar eröffnende Geschäfte abschließt. Denn er begibt sich damit in den unternehmerischen Geschäftsverkehr. Ein Existenzgründer agiert nicht mehr von seiner Rolle als Verbraucher her [...]. Er gibt dem Rechtsverkehr zu erkennen, daß er sich nunmehr dem Recht für Unternehmer unterwerfen und dieses seinerseits auch in Anspruch nehmen will."
Denkbare Doppelrolle
Um Missverständnissen vorzubeugen: Ein und dieselbe Person kann im Alltag durchaus abwechselnd als Verbraucher und als Unternehmer agieren: Hätte ihm der Vertreter an der heimischen Wohnungstür das Abo einer Fernsehzeitschrift angedreht, könnte sich Unternehmer Michael Z. ohne Weiteres auf sein Widerrufsrecht berufen - obwohl die sich daraus ergebende Belastung erheblich geringer gewesen wäre.
Übrigens: Seit der Ärger über seine "Dummheit" verflogen ist, betrachtet Michael Z. seine Erfahrung als ausgesprochen lehrreich: Er weiß jetzt, "wie schnell man sich in große finanzielle Schwierigkeiten bringen kann, wenn man ungeprüft und unachtsam irgendwelche Verträge unterschreibt." Außerdem hat er ein für alle Mal gelernt, mit Werbeleuten umzugehen.
Praxistipps:
- Ganz gleich, ob du in deiner Eigenschaft als Verbraucher oder als (angehender) Unternehmer handelst - am besten sorgst du dafür, dass erst gar kein Widerruf nötig wird:
- Lasse dich niemals unter Druck setzen: Befristete Sonderangebote, begrenzte Stückzahlen oder auch "Extra-Rabatte für Kurzentschlossene" dienen in aller Regel dazu, den Besteller zu vorschnellen, oft sogar kopflosen Entscheidungen zu bewegen.
- Je verlockender ein Angebot erscheint, desto besser ist es, eine Nacht darüber zu schlafen.
- Wenn du dich dadurch allzu sehr in deiner Spontaneität oder Flexibilität eingeschränkt fühlst, setze dir zumindest eine Wertgrenze (z. B. 100, 500 oder 1.000 Euro), ab der du dir eine gründliche Bedenkzeit auferlegst.
- Achte darauf, private Anschaffungen nicht ohne Not als Unternehmer zu bestellen - auch wenn dir als Geschäftskunde unter Umständen eine Vorzugsbehandlung versprochen wird.
- Lasse kostspielige Angebote nach Möglichkeit juristisch überprüfen, bevor du folgenreiche Verpflichtungen eingehst. Unterstützung bekommst du zum Beispiel bei der IHK oder deinem Berufs- bzw. Branchenverband.

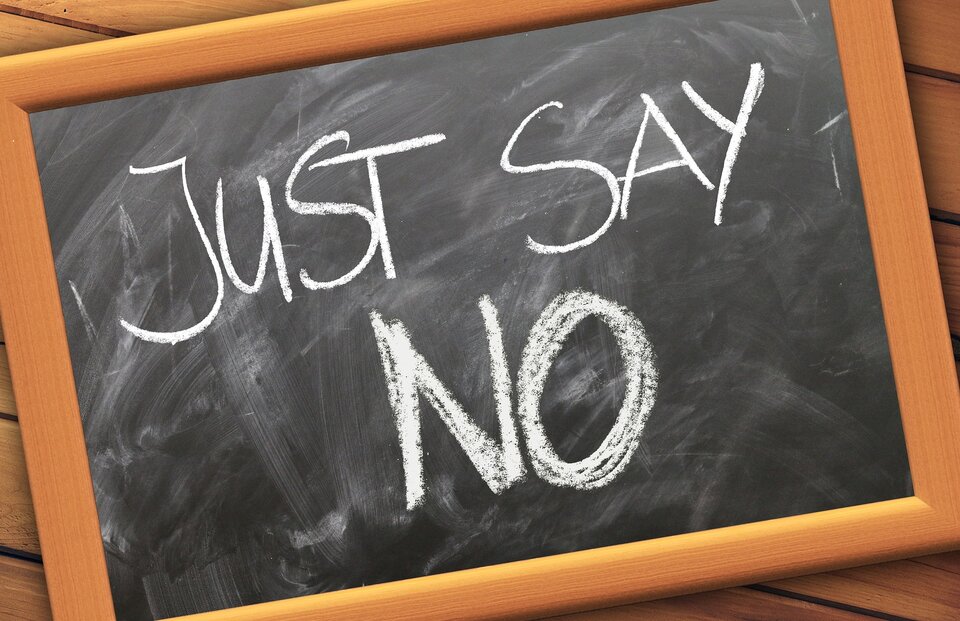

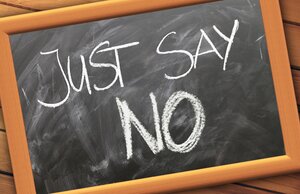
Du möchtest Kommentare bearbeiten, voten und über Antworten benachrichtigt werden?
Jetzt kostenlos Community-Mitglied werden